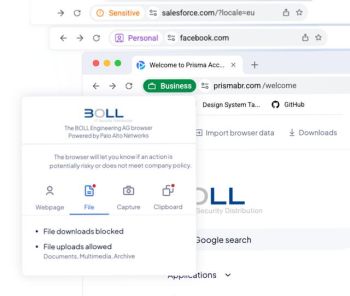Nach den Anschlägen in den USA dauerte es gerade ein paar Stunden, bis die Beamten des FBI bei Mail-Diensten und Internetprovidern mit dem Ansinnen auftauchten, ihr Mailüberwachungssystem DCS1000, besser bekannt unter dem Namen «Carnivore», zu installieren. Zu diesem Zweck wird ein PC mit der DCS1000-Software an den Servern angeschlossen und jedes beim Provider ein- und ausgehende E-Mail überprüft.
Wie das «Wall Street Journal» kürzlich berichtete, soll Carnivore in einer Sekunde Millionen von E-Mails lesen können. Seinen Namen «Fleischfresser» verdankt das Programm der Tatsache, dass es laut FBI nur diejenigen Mails aus der Masse herausfischt, die einen Verdächtigen betreffen, also erkennt, wo «Fleisch am Knochen» ist. Diese werden dann zuhanden der Überwacher kopiert und gespeichert. «Das ist in etwa mit einer Telefonüberwachung zu vergleichen», meinte ein FBI-Mann.
Noch vor einem Monat allerdings hatte Bob Barr, Kongressabgeordneter und Mitglied des Committee of Intelligence, dieses System als «besorgniserregend» bezeichnet, da es, einmal installiert, keine Kontrollmöglichkeiten mehr gebe, wer was mitlese. Seit den Angriffen auf New York und Washington dürften diese Bedenken sehr viel kleiner geworden sein. Das Bewusstsein für den Datenschutz hat sich erst in den letzten Jahren gebildet. Unter dem Eindruck der Anschläge könnte von den Regierungen in den USA wie in Europa und selbst in der Schweiz, wo eine neue Überwachungsgesetzgebung ansteht, die Sicherheit wieder stärker gewichtet werden als der Schutz der Privatsphäre. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Aufregung legt, oder ob die totale Überwachung als das kleinere Übel gesehen wird.
Mit modernster Kryptotechnologie
Alle Überwachung nützt allerdings wenig, wenn Botschaften chiffriert sind und nicht entziffert werden können. Wie die Medien berichten, verfügt der verdächtigte Osama Bin Laden über modernste Technologie und kommuniziert vorwiegend verschlüsselt über Satelliten-Telefon. Aber selbst wenn nicht der zur Zeit am meisten genannte Mann hinter dem Anschlag stecken sollte, verlangte die Vorbereitung des Attentats offensichtlich, dass sich eine grössere Gruppe längere Zeit über internationale Grenzen hinweg verständigte. Dabei konnten die Täter davon ausgehen, dass die internationale Kommunikation abgehört wird, und haben daher vermutlich irgendeine Verschlüsselungstechnik benutzt.
Verschlüsselungsprogramme wie Pretty Good Privacy (PGP) sind frei erhältlich. Textbotschaften könnten zudem mittels Steganografie in Bilddateien versteckt werden. Anonymizer verschleiern den Ursprung einer Mitteilung. Selbst ein herkömmlicher, gut gewählter Wortcode könnte durch das Netz schlüpfen, wenn beispielsweise eine weltweite Internet-Auktionsplattform oder Buchkommentare bei
Amazon.com für versteckte Botschaften verwendet würden. Man kann sich Tausende von Möglichkeiten ausdenken.
Hochtechnologie und Teppichmesser
Geheimdienste wie die amerikanische NSA klagten in den letzten Jahren immer wieder, sie würden in ihrer Arbeit durch die schnelle Entwicklung der Telekommunikation und starke Verschlüsselungen behindert. Die USA behandelten Kryptotechnologien daher lange wie Kriegsmaterial und versuchten, deren Verwendung zu verhindern, solange nicht zumindest die Möglichkeit besteht, durch eingebaute Hintertüren an den Klartext zu gelangen.
Erst auf Druck der Wirtschaft und wegen der liberaleren Praxis anderer Staaten lockerte die US-Regierung schliesslich ihre Politik. Auch bei einem weiter bestehenden Ausfuhrverbot hätten die Terrorristen allerdings relativ leichtes Spiel gehabt, da die Algorithmen, die für hochwirksame Verschlüsselungen benutzt werden, bekannt sind.
Offen bleibt einzig die Frage: Haben die Terroristen wirklich auf verschlüsselte Kommunikation über Internet und Telefon und andere hochtechnische Methoden gesetzt? Dass sie zur Bedrohung von Crew und Passagieren nicht Schusswaffen sondern Teppichmesser aus Plastic benutzten, scheint ihnen geholfen zu haben, die Überwachung im Flughafen auszutricksen. Es wäre ja möglich, dass sie im Wissen um die hochtechnischen Abhörmöglichkeiten auch bei der Kommunikation bewusst primitiv gearbeitet haben. John Le Carre lässt grüssen. (fis)