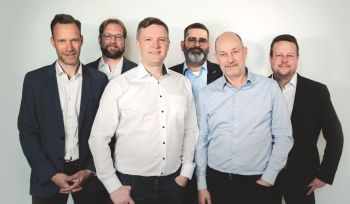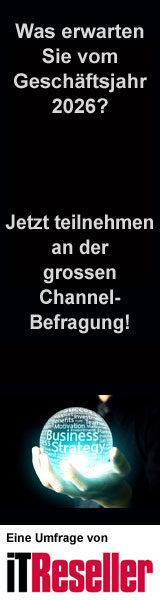Immer weniger Zeit vergeht zwischen Laborexperiment und Praxis. Branchengrössen wie Lucent und
Nortel überbieten sich fast täglich mit neuen Rekordzahlen. Dass es dabei nicht nur um Ruhm und Ehre geht, verdeutlicht eine IDC-Untersuchung, die für 2003 bei einem weltweiten Umsatz in der Internet-Ökonomie von 2,8 Mia. Dollar mit Lieferungen im Wert von 1,5 Mia. für Infrastruktur-Projekte rechnet. Der Bandbreitenhunger der vernetzten Welt scheint unstillbar.
Um dem entgegenzukommen, werden die Lichtsignale in verschiedene Farben aufgeteilt und parallel auf die Reise geschickt. Mit Hilfe von DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) gelingt es bereits, in einer einzigen Glasfaser 96 Farben – oder eben verschiedene Wellenlängen – zu übertragen.
Bei modernen High-End-Geräten sind 10 Gigabit/s über einen einzigen Wellenlängenkanal üblich. Die Labor-Vorführung einer 3,3-Terabit/s-Verbindung durch Lucent basierte auf 40 GBit/s pro Kanal. Nortel demonstrierte kürzlich gar 80 GBit/s über eine Wellenlänge . Bereits im nächsten Jahr sollen DWDM-Systeme mit 240 Wellenlängen pro Glasfaser bei einer Durchsatzrate von 40 GBit pro Wellenlänge auf den Markt kommen.
Doch der Geschwindigkeitsrausch findet immer dann ein jähes Ende, wenn die Lichtsignale für die Regeneration oder das Routing in langsamere, elektronische Signale umgewandelt werden müssen. Diese Vermittlungsstellen bilden Flaschenhälse, die den Tempofreunden regelmässig Grenzen setzen.
Optisches Switching
Abhilfe kann nur ein rein optisches Netzwerk schaffen mit optischen Regeneratoren, Verstärkern und Routern. Die Branchenführer arbeiten auf Hochtouren daran und sind fieberhaft hinter entsprechenden Technologien her (vergl. Kasten). Gegenwärtig stehen für das optische Switching verschiedene Techniken kurz vor der kommerziellen Verwertbarkeit. Man unterscheidet dabei zwischen «Switching Fabrics» mit beweglichen Teilen und solchen ohne.
Zu den ersteren gehören die sogenannten MEMS-Switches (Micro-Electro-Mechanical-Systems), welche die Signale über mikroskopisch kleine Spiegel umlenken. Der von Lucent an der Telecom 99 in Genf vorgestellte Lambda Router etwa benutzt Spiegel, die an zwei Achsen aufgehängt sind und sich daher in jede Richtung drehen lassen. Dabei stehen sich zwei Anordnungen mit je 16 mal 16 Spiegel gegenüber, von denen sich jeder auf 0,01 Grad genau ausrichten lässt.
Ein Lichtstrahl, der über einen der 256 optischen Eingänge des Lambda Routers auf einen der Spiegel trifft, kann von diesem auf jeden beliebigen Spiegel der zweiten Anordnung umgelenkt werden. Dieser wiederum richtet den Lichtstrahl dann auf einen der 256 Ausgänge. Gebremst werden die Photonen durch diesen Umleitungsprozess praktisch nicht.
Auch der von Xros entwickelte Switch arbeitet mit zwei Anordnungen von zweiachsigen Spiegeln. Allerdings bedient er nicht 256 Ein- und Ausgänge wie der Lambda Router von Lucent, sondern 1152. Lucent-Konkurrent
Nortel war das locker 3,25 Milliarden Dollar für eine Übernahme wert.
Andere Systeme arbeiten mit Spiegeln, die sich um eine einzige Achse drehen und auf nur einer Ebene untergebracht sind. Ist ein Spiegel weggeschwenkt, passiert der Lichtstrahl, andernfalls wird er zu einem anderen Ausgang umgelenkt. Der Nachteil dieser Architektur ist leicht ersichtlich: Während der Lambda Router für 256 Ein- und Ausgänge mit 2 mal 256 Spiegeln auskommt, würden dafür bei einem einachsigen Switch 256 mal 256 Spiegel benötigt. Zudem kann im Fall eines defekten Spiegels jeder zweiachsige Spiegel aufgrund seiner Beweglichkeit jeden anderen ersetzen, während bei auf einachsigen Spiegeln basiernden Systemen aus Gründen der Redundanz von vornherein Reservespiegel eingebaut werden müssen.
Blasen statt Spiegel
Einen anderen Ansatz verfolgt die frühere Messtechnik-Abteilung von
Hewlett-Packard, Agilent Technologies. Ihre «Switching Fabric» benötigt keine beweglichen Teile mehr. Statt von Spiegeln werden die Lichtwellen von mikroskopisch kleinen Blasen in die richtige Bahn gelenkt. Die Technik hat Agilent von den von HP entwickelten Bubblejet-Druckern entlehnt.
In Entwicklung ist momentan ein Chip, der 32 optische Ein- und Ausgänge bedient. Dabei wird die ankommende Lichtwelle durch einen Glaskanal, einen sogenannten Waveguide, geführt, der 32 mit Flüssigkeit gefüllte Gräben enthält. Wenn die Flüssigkeit die Normaltemperatur von 65 Grad Celsius hat, passiert das Licht. Falls die Flüssigkeit jedoch erhitzt wird, bildet sich eine Dampfblase, die einen anderen Brechungsindex besitzt. Das auftreffende Licht wird dadurch in einen anderen Waveguide umgelenkt, der zum entsprechenden Ausgang führt.
Der Switch-Pfad wird auf diese Weise innerhalb von zehn Millisekunden aufgebaut. Dies ist insofern wichtig, als die Netzbetreiber den Datenverkehr nur umleiten können, ohne dass der Anwender etwas davon merkt, wenn der Switchvorgang weniger als 50 Millisekunden beansprucht.
Alcatel arbeitet an der Entwicklung von optischen Switching-Elementen aufgrund der Agilent-Technologie. Erste kommerzielle Prototypen sollen Ende Jahr ausgeliefert werden, höhere Stückzahlen sind für 2001 versprochen. Trotz dem Rückstand gegenüber den MEMS-Technologien glaubt Agilent an den Erfolg ihrer Bubble-Technologie, da sie ohne bewegliche und damit fehleranfällige Teile auskommt. Doch welche Systeme sich im Laufe der nächsten Jahre wirklich durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. (fis)