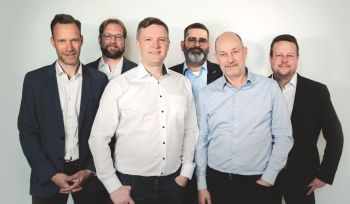Der Bundesrat will neue Rahmenbedingungen für digitale Barrierefreiheit schaffen. Mit der Teilrevision des BehiG sollen private Unternehmen ihre digitalen Angebote so gestalten, dass sie allen Menschen zugänglich sind. Entscheidend ist die Verhältnismässigkeit. Massnahmen müssen zumutbar sein, je nach Unternehmensgrösse, finanziellen Möglichkeiten und Wirkung für Betroffene. Was als angemessen gilt, richtet sich nach dem Unternehmen. Ein kleines KMU wird andere Massnahmen treffen als ein Konzern mit globalem Onlinegeschäft. Für die ICT-Branche bedeutet das eine vorausschauende und pragmatische Anpassung von Prozessen und Produkten.
Zeitplan und Geltungsbereich
Die BehiG-Teilrevision tritt frühestens im Januar 2027 in Kraft. Damit gelten die bisherigen Pflichten des Bundes künftig auch für private Anbieter. Die Revision ist eine von mehreren behindertenpolitischen Gesetzesaktivitäten. Entwürfe und Ausführungsbestimmungen werden präzisieren, was konkret verlangt wird. Bis dahin bleibt die Vorbereitung Sache der Unternehmen.
Parallel dazu ist im Juni 2025 der European Accessibility Act in Kraft getreten. Als EU-Richtlinie verpflichtet er die Mitgliedstaaten, die Vorgaben in nationales Recht zu überführen. Länder wie Deutschland, Österreich oder Italien haben ihre Gesetze bereits angepasst, andere sind noch im Verzug. Anbieter, die ihre Angebote in der EU vertreiben, müssen die neuen Anforderungen berücksichtigen, um konform zu bleiben.
Mit der Teilrevision des BehiG soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten, im Einklang mit europäischen Vorgaben einen Mindeststandard für digitale Barrierefreiheit festzulegen. Als Grundlage wird voraussichtlich der European Accessibility Act dienen. Mittelfristig ist zu erwarten, dass diese Standards auch in der Schweiz gelten werden. Die parlamentarische Debatte zum Behindertengleichstellungsgesetz wird zeigen, wie stark sich die Schweiz bei der digitalen Barrierefreiheit an Europa annähert.
Was das konkret bedeutet
Das europäische Konzept der digitalen Barrierefreiheit basiert auf vier Grundprinzipien:
1. Wahrnehmbar – Inhalte müssen für alle erfassbar sein, über verschiedene Sinneskanäle.
2. Bedienbar – Schnittstellen müssen navigierbar und steuerbar sein, egal welche Eingabemethode jemand nutzt.
3. Verständlich – Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.
4. Robust – Digitale Angebote müssen mit Hilfstechnologien funktionieren, etwa mit Screenreadern, Vergrösserungs-Software oder Sprachsteuerung.
Nach dem European Accessibility Act gelten digitale Dienstleistungen als barrierefrei, wenn sie in Formaten angeboten werden, die assistive Technologien unterstützen. Dazu gehören eine angemessene Schriftgrösse und -form, ausreichender Kontrast und Abstand sowie alternative Darstellungen für Inhalte ohne Text.
Mehr als Pflicht, ein Marktvorteil
Die Debatte zum BehiG wird sich um die Frage drehen, wie die neuen Vorgaben verhältnismässig umgesetzt werden können. Die Einschätzungen dazu werden auseinandergehen. Einig ist man sich jedoch darin, dass digitale Zugänglichkeit technisch realisierbar ist. Rund 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung leben mit einer Behinderung, also über 1,7 Millionen Menschen. Wer seine Angebote zugänglich gestaltet, erschliesst zugleich ein Marktsegment, das bisher oft übersehen wurde. Barrierefreiheit verbessert zudem die Nutzererfahrung insgesamt. Klare Strukturen, kontrastreiche Gestaltung und durchdachte Navigation erleichtern allen den Zugang zu digitalen Diensten. So entsteht durch Inklusion ein Wettbewerbsvorteil.
Was Unternehmen gewinnen
- Wettbewerbsvorteile – In öffentlichen Ausschreibungen zählen Accessibility-Kriterien zunehmend. Wer sie erfüllt, punktet.
- Reputation – Sichtbare soziale Verantwortung stärkt die Marke nachhaltig.
- Bessere Produkte – Accessibility-Kriterien fördern Innovation. Teams, die für unterschiedliche Bedürfnisse designen, entwickeln klarere und nutzerfreundlichere Interfaces.
- Kostenersparnis – Wer Barrierefreiheit von Anfang an integriert, vermeidet teure Nachrüstungen und schafft wartbarere Systeme.
Beratung als Chance
Wer digitale Lösungen entwickelt oder betreibt, sollte Kundinnen und Kunden frühzeitig bei barrierefreien Projekten begleiten. Das ist eine Geschäftschance, denn viele digitale Angebote müssen in den nächsten Jahren überprüft und erneuert werden.
Digitale Barrierefreiheit in der Praxis
Am 4. November 2025 können Sie aus erster Hand erfahren, wie Politik, Verwaltung und Unternehmen digitale Barrierefreiheit umsetzen. Gemeinsam mit Nationalrat Islam Alijaj, dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung und führenden Unternehmen beleuchten wir politische Entwicklungen, praktische Umsetzungen und technische Innovationen. Jetzt anmelden und dabei sein.
Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung «Digitale Barrierefreiheit in der Praxis» (Quelle: Swico)
Die Autorin

Quelle: Thomas Entzeroth
Annika Bos, Public Affairs Managerin bei
Swico und Gremium Swico Digital Ethics Circle