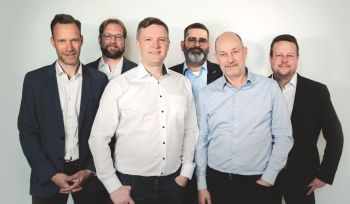Die teilweise hitzigen Auseinandersetzungen um den Einsatz von Open Source in öffentlichen Verwaltungen sind unterdessen einer nüchterneren Betrachtung gewichen. Heute stehen Wirtschaftlichkeit, die gleichzeitige Verwendung mit proprietärer Software und rechtliche Fragen im Vordergrund.
Weltweit setzen Behörden laut einer neuen Studie des britischen Office of Government Commerce heute verstärkt auf Open Source. Als einen der wichtigsten Gründe nennt die Studie Kostenvorteile bei der gesamten IT-Infrastruktur. Insbesondere im Serverbereich sorge Linux dafür, dass ältere Rechner länger eingesetzt werden könnten. Bei der Entscheidung falle aber auch ins Gewicht, dass die öffentlichen Dienste grundsätzlich mit den Entwicklungen im Software- und Hardware-Umfeld Schritt halten möchten.
Als Paradebeispiele nennen die Briten die Stadt München, das norwegische Bergen, wo Datenbank- und Applikationsserver auf Linux migriert werden, das französische Transport-Ministerium, das seine NT-Server mit Linux-Servern konsolidierte, die Stadtverwaltung von Barcelona und die spanische Region Extremadura mit ihrem Open-Source-Netzwerk.
Die Kostenwirksamkeit wird allerdings in der Studie nicht mit genauen Zahlen untermauert. Dennoch ist für den Chef des Office of Government Commerce, John Oughton, mit solchen Projekten der Nachweis erbracht, dass Open Source den Regierungsstellen zu effizienten IT-Lösungen verhelfen kann.
Hauptargument: Die Kosten
Die Kostenfrage bildet auch für die meisten Anwender ein wichtiges Argument. So meinte etwa der Leiter des Amts für Information und Datenverarbeitung der Stadt München, Wilhelm Hoegner, auf dem Linux-Kongress Vorarlberg Mitte dieses Monats, man höre oft, die Umstellung auf Open Source sei eine blosse Spielerei, aber: «Man glaubt gar nicht, was das im Kostenvergleich ausmacht.»
Ins gleiche Horn stiess Horst Bräuner, IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall. Ein erheblicher Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen zwang dort zu Einsparungen. «In meinem Bereich habe ich das mit Linux und Thin Clients gemacht», sagte Bräuner, «die Umstellungen inklusive Schulungen und Anschaffungen haben wir ohne zusätzliches Budget durchgeführt. Gleichzeitig konnten wir unsere Leistungen erweitern, etwa mit VPN, dem ‹mobilen Rathaus› in Form von Laptops mit Anwendungen auf Open-Source-Basis und einem Gigabit-Netzwerk.»
Bereits auf «Tausend Tage Tux» kann die deutsche Kleinstadt Treutlingen zurückschauen. Die Einsparungen durch die Kombination von Open-Source-Software, Linux und Thin Clients sollen dabei deutlich höher ausgefallen sein als die prognostizierten 21 Prozent. Dabei ging es anfangs gar nicht um Geld, sondern um die Tatsache, dass sich zwei Windows-Programme partout nicht vertragen wollten.
Ähnlich lagen die Gründe für die Stadtverwaltung Wien, wo bereits 1989 mit der Etablierung von Unix und freier Software begonnen worden war. Peter Pfläging, Leiter der Abteilung Netzwerk und Security, betont: «Open Source war für uns nie eine religiöse, sondern immer eine pragmatische Entscheidung. Es war zum Beispiel ohne Open-Source-Tools einfach nicht möglich, gewisse Daten zu konvertieren.»
Die Haltung des Bundes
In der Schweiz hat der Informatikrat des Bundes zu Beginn dieses Jahres die Open-Source-Strategie der Bundesverwaltung verabschiedet. Wie der Delegierte für die Informatikstrategie des Bundes, Jürg Römer, betont, gelten für die Beurteilung von freier Software die gleichen Kriterien wie für proprietäre, nämlich Wirtschaftlichkeit, Qualität und Interoperabilität.
Die Bundesverwaltung erhofft sich so, auch wenn freie Software nicht aktiv gefördert werden soll, mehr Handlungsspielraum. Im April dieses Jahres wurde mit der Umsetzung von acht Teilprojekten begonnen, die bis 2005 abgeschlossen sein sollen.
Sparen ist auch beim Bund ein Motiv, wie Dieter Klemme vom Informatikorgan Bund ausführt. «Zurzeit wird eine Kostenleistungsrechnung eingeführt, derzufolge die Dienststellen die Rechenzentren für ihre Leistungen bezahlen müssen. Um die Kosten tief zu halten, strebe man die Wiederverwendbarkeit von Software durch verschiedene Abteilungen und Dienststellen an. Für die Berechnung der Total Cost of Ownership wurde ein eigenes Tool entwickelt. Wie die Analysen ergeben hätten, seien die angestrebten Ziele am besten mit Linux und offener Software zu erreichen.
Rechtliche Risiken
Die Patentstreitigkeiten zwischen SCO und
IBM hatten in München dazu geführt, dass das Open Source-Migrationsprojekt der Stadtverwaltung im August vorübergehend ins Stocken geraten war. Die Rechtssicherheit bei Open-Source-Software wird daher zurzeit hinterfragt. Die Berner Anwältin Ursula Widmer, die im Auftrag der Bundesverwaltung ein entsprechendes Gutachten erstellte, meint an einer vom Informatikstrategieorgan Bund und der Privaten Hochschule für Wirtschaft organisierten Tagung in Bern im September, das Open-
Source-Konzept sei durch den Rechtsstreit nicht grundsätzlich tangiert: «Grundsätzlich gibt es keine rechtlichen Gründe gegen den Einsatz von freier Software in öffentlichen Verwaltungen. Die Risiken sind beherrschbar.»
Die Rechtslage ist, wie Widmer ausführte, allerdings noch unklar. Die Gültigkeit vieler Software-Patente sei fraglich. Davon seien jedoch Nutzer von Open-Source- und proprietärer Software gleichermassen betroffen.
Um das Risiko zu minimieren, schlägt sie Vereinbarungen mit den Anbietern vor, etwa Verträge mit kommerziellen Distributoren.
Bei der Weitergabe von selbst entwickelten Lösungen, schreibt Widmer in ihrem Gutachten, sei allerdings Vorsicht geboten, da die Rechtspraxis in Bezug auf Haftungsfragen noch nicht gefestigt sei. (fis)