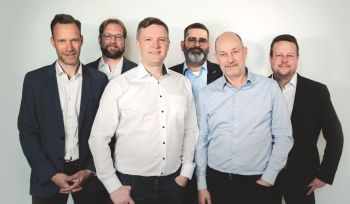Zertifizierungen gehören seit jeher zum festen Bestandteil vieler Partnerprogramme in der IT-Branche. Sie dienen dem Partner einerseits dazu, Know-how aufzubauen, um seine Kunden kompetent zu beraten und Lösungen fachgerecht implementieren zu können. Gleichzeitig sollen sie vorhandenes Know-how belegen und sind oftmals auch Bedingung, um einen bestimmten Partnerstatus beim Hersteller überhaupt erlangen zu können.
Doch wie relevant sind diese Nachweise im täglichen Geschäft tatsächlich – und wie unterscheiden sich verpflichtende Zertifizierungen von optionalen Weiterbildungen? Wie hoch ist der Aufwand, der für die Zertifizierungen aufgewendet werden muss, und welche Kosten entstehen dabei? Mit diesen und weiteren Fragen sind wir auf die fünf Hersteller
AWS,
Eset,
HP Schweiz,
Huawei Technologies Switzerland und
Salesforce zugegangen.
Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Konzepte
Bei
Salesforce wird zwischen verpflichtenden und freiwilligen Zertifikaten nicht grundsätzlich unterschieden. Für die Teilnahme am Partnerprogramm ist der Nachweis von mindestens zwei Zertifizierungen erforderlich. Dabei schreibt Salesforce keine bestimmten Inhalte vor, sondern lässt den Partnern die Wahl aus dem gesamten Zertifizierungsportfolio. Ergänzend ist ein Punktesystem relevant für die Partnerstufen, wobei Zertifizierungen neben weiteren Faktoren mit einfliessen. Bei
Huawei müssen Partner gewisse Zertifizierungen nachweisen, um bestimmte Spezialisierungen zu erreichen. Gleichzeitig steht es ihnen offen, sich durch weitere Zertifikate in Bereichen zu qualifizieren, die über die Mindestanforderungen hinausgehen – etwa zur persönlichen Karriereentwicklung.
HP Schweiz differenziert klar zwischen den für den Partnerstatus notwendigen Zertifizierungen, die sich auf konkrete Produktbereiche beziehen, und zusätzlichen Trainingsangeboten. Ein besonderer Schwerpunkt liege aktuell im Bereich Künstliche Intelligenz, wo man ein breites Schulungsportfolio anbiete – vom Einstiegskurs bis hin zu branchenspezifischen Management-Trainings, so der PC-Hersteller. Bei
Eset ist die Situation so, dass alle Partner auf sämtliche Inhalte im Eset Education Portal zugreifen können – unabhängig des Partnerstatus. «Einige Trainings sind für bestimmte Partnerstufen zwar verpflichtend, der Grossteil kann aber auch freiwillig absolviert werden. Gerade für spezialisierte Partner oder Mitarbeiter im Presales lohnt sich das», erklärt hierzu Alexander Opel, Product Technology & Education Manager, Eset Deutschland.
Bei AWS schliesslich wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Zertifizierungen unterschieden. Einerseits gibt es Zertifizierungen, die für den Partnerstatus erforderlich sind, andererseits freiwillige Zertifizierungen. «Diese ermöglichen eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Machine Learning, Security, Migrations oder Data Analytics», erklärt Christoph Schnidrig, Head of Technology Alps bei
AWS. Das System sei dabei flexibel aufgebaut und erlaube es den Partnern, sich gezielt je nach Bedarf weiterzuentwickeln.
Laura Strathemann, Senior Manager, Partner Engagements, Salesforce (Quelle: Salesforce)
Interesse an freiwilligen Zertifizierungen ist da
Dass das Thema Zertifizierungen nicht nur lästige Pflicht für die Partner ist, zeigt das Interesse nach den verschiedenen angebotenen freiwilligen Zertifizierungen, das laut den Herstellern gross und gemäss
AWS in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Besonders gefragt sind hier laut Christoph Schnidrig Spezialisierungen in Bereichen wie Generativer KI, Security und Data Analytics. Die Vorteile für Fachkräfte würden von besseren Karrierechancen und Vergütungen bis hin zu Zugang zu zusätzlichen Ressourcen oder auch zu einem exklusiven AWS-Zertifizierungs-Netzwerk reichen. Für Unternehmen ergeben sich laut Schnidrig derweil Wettbewerbsvorteile bei Ausschreibungen und ein gestärktes Standing im Markt durch nachgewiesene Kompetenz.
Bei
Salesforce hängt die Nachfrage nach freiwilligen Zertifizierungen stark von der strategischen Ausrichtung des Partners ab, wie Laura Strathemann, Senior Manager, Partner Engagements, erklärt. «Eine hohe Anzahl an zertifizierten Spezialistinnen und Spezialisten signalisiert potenziellen Kunden jedoch, dass ein Partner über die nötige Kapazität und Fachkompetenz verfügt, um bestimmte Projekte erfolgreich umzusetzen.» Bei Salesforce seien diese Informationen öffentlich einsehbar, was sich direkt auf die Beauftragung als Systemintegrator auswirken könne.
Huawei betont vor allem den Wissenstransfer rund um freiwillige Zertifizierungen. Diese würden Mitarbeitenden helfen, ein vertieftes Verständnis für ICT-Grundlagen sowie aktuelle Technologien in Huawei-Lösungen zu entwickeln, was wiederum Vertrauen beim Kunden schaffe und dem Unternehmen zu neuen Geschäftsmöglichkeiten verhelfen könne.
Eset stellt den Nutzen freiwilliger Zertifizierungen in einen praxisorientierten Zusammenhang: «Wer sich wirklich in unsere Produkte reinkniet, holt auch mehr raus», so Alexander Opel. Zertifizierte Mitarbeitende könnten nicht nur besser beraten, sondern auch den Support entlasten und aktiv zum Geschäftserfolg beitragen. «Unternehmen profitieren davon direkt: durch zufriedenere Kunden, mehr Abschlüsse und einen besseren Draht zu uns als Hersteller.»
Yang Wang, Direktor der Enterprise Business Group, Huawei Technologies Switzerland (Quelle: Huawei)
Aufwand und Intervalle variieren
Wie viel Zeit Fachkräfte in Zertifizierungen investieren müssen, hängt stark vom gewählten Programm und dem individuellen Kenntnisstand ab – eine allgemeingültige Aussage lässt sich kaum treffen.
Eset beispielsweise setzt auf kurze, modulare Lerneinheiten. Die Trainings dauern in der Regel nur wenige Stunden und lassen sich flexibel unterbrechen und fortsetzen, so Alexander Opel. «Es gibt keine zusätzlichen Aufwände und auch keine Pflicht, regelmässig an Schulungen teilzunehmen. Wer sich auf dem Laufenden halten will, kann das im eigenen Tempo tun.»
Huawei gibt derweil an, dass sich Grundzertifikate wie HCSA oder HCIA innerhalb von ein bis zwei Monaten absolvieren lassen, weiterführende Programme wie HCSP oder HCIP dauern rund zwei bis drei Monate. Für die höchsten Zertifizierungsstufen (HCSE/HCIE) seien drei bis sechs Monate einzuplanen – inklusive Online- und Offline-Lernen sowie einer Lab-Prüfung.
«Für notwendige Zertifizierungen fallen je nach Partnerstatus zwei bis drei Stunden Aufwand pro Jahr und Person an», beziffert Daniel Esslinger den Aufwand für PC-Partner. Die freiwilligen Trainings seien variabler gestaltet und lassen sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren. Die AI Masterclass etwa, die laut Daniel Esslinger aktuell auf grosses Interesse stösst, dauert beispielsweise acht Stunden.
AWS schliesslich erklärt, dass der Aufwand besonders stark mit dem Zertifizierungsniveau variiert. Einsteigerzertifikate wie der
AWS Cloud Practitioner lassen sich mit wenigen Tagen Vorbereitung absolvieren. Fortgeschrittene Programme, etwa im Bereich Machine Learning oder Netzwerkarchitektur, erfordern hingegen mehrere Monate intensiver Vorbereitung. Neben Schulung und Prüfung fallen oft zusätzliche Zeiten für praktische Übungen, kontinuierliche Weiterbildung und Rezertifizierungen an. Christoph Schnidrig bezeichnet diese höheren Zertifikate als «substanzielles Investment in Know-how und Zeit», das sich jedoch durch den damit verbundenen Mehrwert für Fachkräfte und Unternehmen auszahle.
Um sicherzustellen, dass Fachwissen aktuell bleibt und Partner mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten, setzen alle befragten Hersteller auf regelmässige Re-Zertifizierungen – mit unterschiedlichen Intervallen und Anforderungen.
Salesforce etwa verlangt jährlich den Abschluss eines sogenannten Maintenance-Moduls für jedes Zertifikat. Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob jemand Partner, Endkunde oder Salesforce-Mitarbeitender ist. Damit werde sichergestellt, dass alle Zertifizierten auf dem neuesten Stand der Plattform bleiben, so Laura Strathemann. Huawei legt die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten in der Regel auf zwei Jahre fest. Nach Ablauf dieser Zeit sind Partner verpflichtet, innerhalb von drei Monaten neue Zertifikate zu erwerben. Bei
HP Schweiz sei die Re-Zertifizierung jährlich vorgesehen, allerdings in einem unkomplizierten Rahmen. Wie Daniel Esslinger erklärt, genügt oft schon die Teilnahme an einer virtuellen Roadshow, um diese Anforderung zu erfüllen. Eset differenziert je nach Bereich. Im Vertrieb müssen Zertifizierungen spätestens alle zwei Jahre erneuert werden. Technisch gesehen reicht es aus, wenn Partner sich bei neuen Inhalten oder Funktionen weiterbilden. Ziel sei es, den Aufwand möglichst gering zu halten. AWS schliesslich arbeitet mit einem Drei-Jahres-Zyklus: Nach diesem Zeitraum ist eine erneute Prüfung erforderlich, um den Partnerstatus zu sichern. «Diese Praxis stellt sicher, dass AWS-Partner stets über aktuelles Wissen zu den sich schnell entwickelnden Cloud-Technologien und -Services verfügen», betont Christoph Schnidrig.
Daniel Esslinger, Commercial Channel Manager, HP Schweiz (Quelle: HP)
Die Kostenfrage
Die Durchführung der Schulungen und Prüfungen sowie die damit verbundenen Kosten unterscheiden sich je nach Anbieter deutlich – sowohl im Umfang als auch in der Struktur. Bei
Salesforce erfolgt das Training im Selbststudium über die Lernplattform Trailhead – kostenlos und flexibel, wie Laura Strathemann sagt. Zertifizierungsprüfungen hingegen werden über die Trailhead Academy abgelegt und kosten je nach Art der Prüfung zwischen 75 und 400 US-Dollar. «Salesforce-Partnerunternehmen erhalten je nach Partnerstatus kostenfreie Prüfungsgutscheine sowie Rabatte auf Trainings und Prüfungen», fügt Laura Strathemann noch an. Solche Trainings- und Prüfungsgutscheine kennt man auch bei
Huawei. Grundsätzlich müssen Partner bei Huawei aber selbst für die Ausbildungskosten ihrer Mitarbeitenden aufkommen. Gleichzeitig stelle man aber auch kostenlose Lernmaterialien und Videos zur Verfügung, wie Yang Wang, Direktor der Enterprise Business Group, Huawei Technologies Switzerland, ergänzt.
HP Schweiz bietet seine Basis-Schulungen über eine virtuelle Plattform kostenfrei an. Für vertiefte Trainings mit Prüfungsabschluss fallen Kosten von rund 100 US-Dollar pro Teilnehmenden an. Daniel Esslinger betont, dass damit auch die Beratungsqualität der zertifizierten Fachkräfte sichergestellt werde – insbesondere bei beratungsintensiven Lösungen.
Eset stellt sämtliche Inhalte über das firmeneigene Education Portal kostenlos bereit. Die Schulungen sind interaktiv und praxisnah aufgebaut, Prüfungen erfolgen direkt online im Anschluss an das Training. Zusätzliche Kosten entstehen dabei nicht.
AWS bietet ein breit gefächertes Schulungsangebot an – sowohl über die eigene Plattform als auch über autorisierte Partner, Bildungseinrichtungen und Online-Anbieter. Die Zertifizierungsprüfungen selbst werden ausschliesslich über autorisierte Prüfungszentren durchgeführt. Die Prüfungsgebühren liegen typischerweise zwischen 80 und 240 Franken. Vorbereitungskurse können je nach Anbieter und Intensität zwischen 500 und 3000 Franken kosten.
AWS weist zudem darauf hin, dass Online-Lernressourcen oft mit monatlichen Gebühren verbunden sind und die konkreten Preise je nach Anbieter variieren können.
Alexander Opel, Product Technology & Education Manager, Eset Deutschland (Quelle: Eset)
Die Zukunft von Zertifizierungen
Abschliessend wollten wir von den Herstellern noch wissen, wie sich das Geschäft mit Zertifizierungen in Zukunft verändern wird – etwa durch KI-unterstützte, personalisierte oder adaptive Trainings.
Huawei etwa erwartet einen deutlichen Anstieg von KI-gestützten Prüfungsprozessen – etwa durch automatisierte Auswertungen, Remote-Prüfungen und digitale Audits. Das soll den Zertifizierungsprozess beschleunigen und gleichzeitig mehr Flexibilität ermöglichen. «Gleichzeitig wird der Bedarf an Fachwissen in neuen Technologien wie Cloud Computing, Blockchain und künstlicher Intelligenz weiter an Bedeutung gewinnen, was das Wachstum des Weiterbildungsmarkts zusätzlich antreiben dürfte», ist Yang Wang überzeugt.
HP Schweiz setzt laut Angaben von Daniel Esslinger bereits heute auf ein hohes Mass an Individualisierung in seinem AI Hub. Ob und wie KI künftig die Lernprozesse unterstützt, werde derzeit evaluiert. Der Fokus liege weiterhin auf kostenlosen, praxisnahen Inhalten mit echtem Mehrwert für den Arbeitsalltag.
Eset erklärt zum Thema KI, dass diese helfen könne, Trainings noch individueller und effizienter zu machen, zum Beispiel durch personalisierte Lernpfade oder gezieltes Feedback. Alexander Opel betont zudem die wachsende Bedeutung lokalisierter Inhalte, um die Schulungsangebote sprachlich noch zugänglicher zu machen.
Christoph Schnidrig von
AWS schliesslich erklärt zu den Veränderungen rund um Zertifizierungen: «Die Zukunft der Cloud-Zertifizierungen wird massgeblich von technologischen Innovationen und neuen Lernformaten geprägt sein – dabei rückt die praktische Erfahrung noch stärker in den Mittelpunkt.» Er erwähnt KI-gestützte, adaptive Lernpfade, die gezielt Wissenslücken erkennen und sich dynamisch an den Lernfortschritt anpassen. Gleichzeitig werde der Fokus auf praktische Erfahrung intensiviert: Programme wie der AWS Free Tier ermöglichen es Lernenden, reale Cloud-Szenarien mit bis zu 200 Dollar Guthaben durchzuspielen, so Schnidrig. Microlearning, kontinuierliche Weiterbildung und die enge Verzahnung von Lerninhalten mit alltäglichen Arbeitsaufgaben sollen Zertifizierungen künftig noch relevanter machen – weg von reinen Theorieprüfungen, hin zu praxisnahen Kompetenznachweisen.
Christoph Schnidrig, Head of Technology Alps, AWS (Quelle: AWS)
Mehr Kompetenz und Sichtbarkeit
Die Aussagen der Hersteller zeigen: Zertifizierungen sind mehr als nur formale Anforderungen im Rahmen eines Partnerprogramms. Sie dienen dem Kompetenzausbau, der Marktpositionierung und stärken letztlich die Kundenbindung. Alexander Opel von
Eset bringt es auf den Punkt: «Zertifizierungen bringen Partnern nicht nur mehr Know-how, sondern auch mehr Sichtbarkeit. Wer fit in unseren Lösungen ist, kann beim Kunden souveräner auftreten und hebt sich vom Wettbewerb ab. Gleichzeitig sinkt das Support-Aufkommen, weil viele Fragen direkt vom Partnerteam gelöst werden können. Unterm Strich eine Win-Win-Situation.»
Zertifizierungen sind allerdings kein Selbstzweck. Sie verlangen vor allem Zeit, Engagement und teils auch finanzielle Investitionen – doch sie ermöglichen den Zugang zu tiefgreifendem Fachwissen, stärken die Kundenbeziehungen und schaffen Vertrauen. In einer IT-Welt, die sich ständig verändert, werden sie damit zu einem strategischen Werkzeug – sowohl für die individuelle Weiterentwicklung als auch für die langfristige Positionierung im Markt.
(mw)